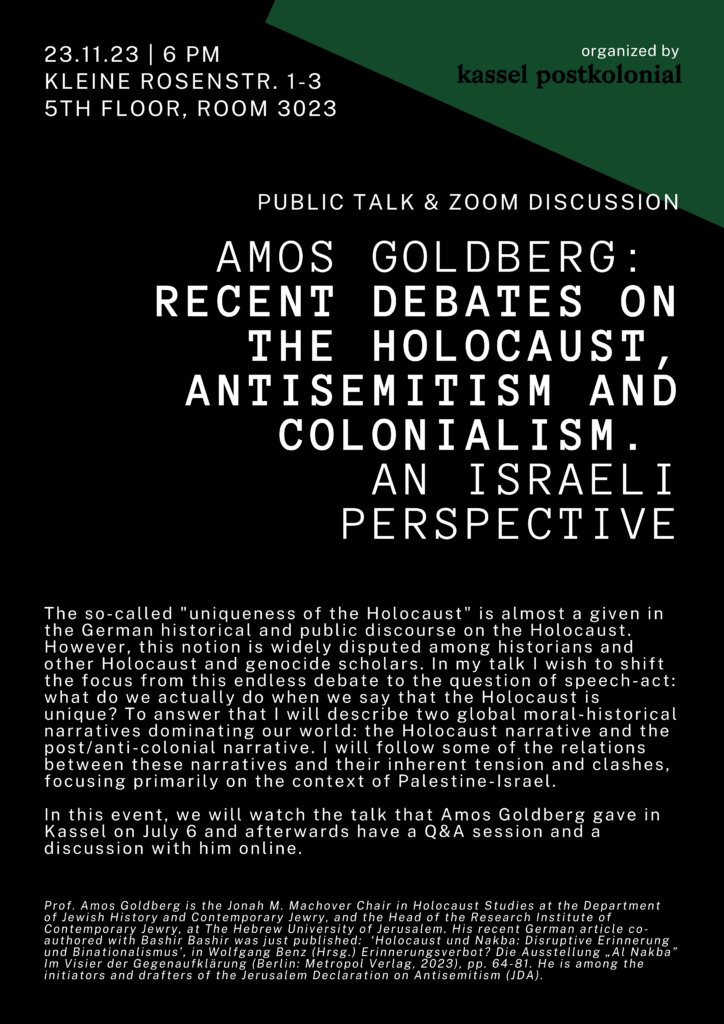Montag, 26. Mai 2025
18:30 – 21:30
@LiZA (Die Freiheit 19)
Der Eintritt ist frei.
Der Film wird im englischen Originalton sowie mit englischen Untertiteln gezeigt.
„Under the Hanging Tree“ ist ein Film, der von dem jungen, vielversprechenden namibischen Filmemacher Perivi Katjavivi geschrieben, inszeniert und produziert wurde. Der Film ist keine historische Rekonstruktion, sondern erzählt von gegenwärtigen Figuren, die mit ihrer Vergangenheit konfrontiert werden. Eine Polizistin wird zu Ermittlungen auf eine deutsche Farm in einer ländlichen Region geschickt, in der einst der Völkermord stattfand. In der Geschichte wird ein deutscher Farmer an einem Baum aufgehängt aufgefunden – demselben Baum, an dem während der Kolonialzeit deutsche Soldaten Herero aufgehängt haben. Um den Fall zu lösen, muss die Polizistin Muretis sich mit ihrer eigenen Herero-Identität auseinandersetzen.
Katjavivi kombiniert bei der visuellen Darstellung der Themen Landschaftsporträts im Stil gerahmter Dias mit bedrohlich-dynamischen Kamerawinkeln. Er nutzt mystische Elemente und eine Bildsprache, die an Horrorfilme erinnert, um eine Film-Noir-Geschichte zu erschaffen. Die düstere koloniale Vergangenheit beeinflusst die Gegenwart, das Leben der Individuen, die zwischenmenschlichen Beziehungen und die Machtverhältnisse. Katjavivis Filme behandeln politische Themen und beleuchten die Schattenseiten der namibischen Gesellschaft. Seine Erzählungen verdeutlichen die verheerenden Auswirkungen des Kolonialismus, die bis heute spürbar sind.
—–
Under the Hanging Tree” is a film written, directed and produced by the young, promising Namibian filmmaker Perivi Katjavivi. The film is not a historical reconstruction, but tells the story of present characters who are confronted with their past. A policewoman is sent to investigate a German farm in a rural region where the genocide once took place. In the story, a German farmer is found hanging from a tree – the same tree from which German soldiers hanged Herero during the colonial era. In order to solve the case, policewoman Muretis must come to terms with her own Herero identity.
Katjavivi combines landscape portraits in the style of framed slides with menacing, dynamic camera angles in the visual presentation of the themes. He uses mystical elements and a visual language reminiscent of horror films to create a Film Noir story. The dark colonial past influences the present, the lives of individuals, interpersonal relationships and power relations. Katjavivi’s films deal with political themes and shed light on the darker side of Namibian society. His stories illustrate the devastating effects of colonialism, which can still be felt today.